Relevanz und Übersicht
Der Mensch braucht Energie, um zu leben, aber auch, um sein Leben gestalten zu können. Das heutige Leben, wie wir es kennen, wäre ohne Energieproduktion und -nutzung nicht dasselbe. Um die Zukunft aktiv und verantwortungsvoll mitzugestalten, sollen sich Lernende mit dem Thema auseinandersetzen. Dabei werden der Begriff Energie, die Produktion und die Nutzung thematisch so aufbereitet, dass bei den Lernenden eine Verknüpfung zur Nachhaltigen Entwicklung entsteht.
Energie erleben die Lernenden täglich in ihrem Alltag. Phänomene im Zusammenhang mit Energie werden von allen erlebt, doch oft nicht hinterfragt. Um tragfähige Konzepte für die Erklärungen solcher Phänomene aufzubauen, braucht es eine fragende, forschende und entdeckungsfreudige Haltung. Die Lehrperson unterstützt die Lernenden dabei.
Vorstellungen und Vorkenntnisse
Strom wird oft fälschlicherweise als Synonym für Energie verwendet, doch es ist wichtig, diesen Unterschied im Unterricht zu betonen. Strom ist lediglich ein umgangssprachlicher Ausdruck und nicht identisch mit dem Begriff "Energie". Daher sollten Lehrkräfte darauf achten, den korrekten Begriff "Energie" zu verwenden.
Viele Lernende sind nicht vertraut mit der Erzeugung von Strom und der Nutzung von Energie. Sie sind sich oft nicht bewusst, welche Menge an Energie benötigt wird, um beispielsweise eine Bewegung auszuführen, Nahrung zu verdauen oder das Licht einzuschalten.
Um solche Fehlvorstellungen aufzudecken und zu klären ist es hilfreich, individuelle Gespräche, Diskussionen in Kleingruppen oder im Klassenverband zu führen. Auf diese Weise kann die Lehrperson die Missverständnisse der Lernenden identifizieren und im Unterricht behandeln, um so einen Konzeptwandel herbeizuführen.
Lerngegenstand und thematische Schwerpunkte
| Energie |
Dieser thematische Schwerpunkt widmet sich dem Begriff Energie, und wie Lernende Energie in ihrem Alltag nutzen. Die Lernenden setzen sich mit verschiedenen Energieträgern auseinander, erforschen, wie diese Strom erzeugen und welche Vor- und Nachteile damit verbunden sind. Teilweise werden die Aufgaben im IdeenSet durch den Einsatz von Modellen begleitet. Sie sollen den Lernenden helfen, komplexe Vorgänge wie beispielsweise die Energieerzeugung zu verstehen. Modelle reduzieren die Informationen auf das Wesentliche und stellen den Sachverhalt grafisch dar. Das Thema Energie soll nicht nur aus naturwissenschaftlicher Sicht behandelt werden, sondern auch andere Perspektiven integrieren. Beispielsweise sollen philosophische Diskussionen stattfinden: Wie sähe unser Leben ohne allfällige Energienutzung aus? Oder: Wie wäre es, wenn die Energieverteilung auf der Erde gleichmässig wäre? Diese integrative Herangehensweise ermöglicht es den Lernenden, ein breiteres Verständnis von Energie zu entwickeln. |
| Elektrizität |
In diesem thematischen Schwerpunkt sollen die Lernenden konkrete Erfahrungen mit Elektrizität als einer Form der nutzbaren Energie machen. Sie führen Experimente durch und halten ihre Erkenntnisse in verschiedenen Formen fest, um das forschend-entdeckende Lernen zu unterstützen. Durch aktives Bearbeiten von Aufgaben rund um den Stromkreis werden den Lernenden naturwissenschaftliches Denken, Arbeiten und Handeln vermittelt. Ein digitaler Zeitstrahl ermöglicht es den Lernenden, relevanten Persönlichkeiten zu begegnen, die mit der Entdeckung und Nutzung der Elektrizität in Verbindung stehen, angefangen von Otto von Guericke über Benjamin Franklin bis hin zu Thomas Edison. Darüber hinaus werden die Lernenden sensibilisiert für diejenigen Gegenstände in ihrer Umgebung, die von Elektrizität abhängig sind.
|
| Transport und Mobilität | Mobilität ist eng mit Energie verbunden, denn unsere Verkehrsmittel brauchen allesamt Energie, damit sie funktionieren. Durch deren Einsatz ergeben sich unterschiedliche Herausforderungen, welche das Thema "Energie" betreffen. Mittels eines Mobilitätstagebuchs sollen die Lernenden reflektieren und sich bewusst werden, welchen Teil sie zur Lösung beitragen können. |
Verlauf und Lehrplanbezug
Organisation
Die Lernaufgaben wurden mit zebis.digital erstellt, was eine digitale Bearbeitung der Aufgaben ermöglicht. Der Lern-Code wird für das Speichern von persönlichen Lernfortschritten gebraucht. Wird auf der Seite mit der Kapitelübersicht der Schieberegler (oben rechts) auf "Speichern" umgestellt, erhalten die Lernenden diesen Code. Wichtig zu wissen: Der Code garantiert die Einsicht in den gespeicherten, individuellen Lernfortschritt.
Die Organisation der einzelnen Aufträge und das benötigte Material sind für die Lernenden jeweils in den Lernaufgaben beschrieben. Material, welches von der Lehrperson für diese Aufgaben bereitgestellt werden muss, ist hier aufgeführt:
Themenschwerpunkt Energie:
Erneuerbare und nicht erneuerbare Energieformen
- 5. Baue eine Solaranlage: Schuhschachteln oder ähnlich grosse Kartons, schwarzes Papier, Klebestifte, Scheren, Frischhaltefolie
- 8. Baue ein Windrad: A4-Papier, Reissnägel, kleine Holzstäbe oder lange Zahnstocher
- 9. Teste die Funktion deines Windrads: Haarföhn
Themenschwerpunkt Elektrizität:
Elektrizität im Alltag
- 3. Der Stromkreis: Kabel, Glühbirnen, Halterungen für Glühbirnen, Batterien
- 4. Glühlampe vs. LED-Lampe: Kabel, LED-Lämpchen, Halterungen für Glühbirnen, Batterien
Themenschwerpunkt Transport und Mobilität:
- 2. Graue Energie – Obst und Gemüse: Prospekte von Schweizer Detailhändler*innen (z.B. Coop, Migros, Aldi, Lidl usw.)
Verlauf
| Didaktische Phase * | Aufgaben |
|---|---|
|
Explorieren erkunden, begegnen, Vorwissen und Erfahrungen aktivieren, Konzepte prüfen und hinterfragen, aktiventdeckend |
In allen drei Themenschwerpunkten gibt es für Lernende Raum zum Begegnen und aktive Erfahrungen zu machen. Beispiele:
Themenschwerpunkt «Elektrizität»
Themenschwerpunkt «Transport und Mobilität»
|
|
Erarbeiten neue Konzepte und Handlungsweisen kennenlernen, ordnen |
|
|
Beispiele:
Themenschwerpunkt «Elektrizität»
Themenschwerpunkt «Transport und Mobilität»
|
|
|
Üben und Vertiefen trainieren, erweitern, für sich verfügbar machen
|
|
|
Durch diverse Bezüge in den Aufgabenstellungen wird bereits erlerntes Wissen immer wieder abgefragt und mit dem neu Erlernten in Verbindung gebracht. Beispiele:
Themenschwerpunkt «Elektrizität»
Themenschwerpunkt «Transport und Mobilität»
|
|
|
Anwenden in bekannten Situationen
Übertragen in unbekannten Situationen |
Beispiele:
Themenschwerpunkt «Elektrizität»
Themenschwerpunkt «Transport und Mobilität»
|
* Die didaktischen Phasen basieren auf dem Modell kompetenzfördernder Aufgabensets nach Kalcsics & Wilhelm, 2017.
Nachhaltige Entwicklung
Das Thema Energie bietet vielerlei Anknüpfungspunkte, um Lernende in die Thematik der Nachhaltigen Entwicklung einzuführen oder ihre Anwendungskompetenzen in diesem Bereich zu stärken.
Lesen und schreiben, sich informieren, eine Meinung haben und diese im Gespräch einbringen sind notwendige Voraussetzungen, damit sich die Lernenden an einer Nachhaltigen Entwicklung beteiligen und diese mitgestalten können.
Bildung soll den Menschen helfen, den eigenen Platz in der Welt zu reflektieren und darüber nachzudenken, was eine Nachhaltige Entwicklung für die eigene Lebensgestaltung und das Leben in der Gesellschaft bedeutet. Es geht darum, Wissen und Können aufzubauen, das die Menschen befähigt, Zusammenhänge zu verstehen, sich als eigenständige Personen in der Welt zurechtzufinden, Verantwortung zu übernehmen und sich aktiv an gesellschaftlichen Aushandlungs- und Gestaltungsprozessen für eine ökologisch, sozial und wirtschaftlich Nachhaltige Entwicklung zu beteiligen.» (Auszug aus dem Lehrplan 21)
Beurteilung
Die Lernenden berichten einander in regelmässigen Abständen, was sie bereits herausgefunden haben und welche Schlüsse sie daraus ziehen. Diskussionsmöglichkeiten sind in allen Themenschwerpunkten vorhanden. Die Lehrperson erhält dadurch die Gelegenheit, den individuellen Lernprozess der Lernenden einzuschätzen und wo nötig zu unterstützen.
Eine weitere Möglichkeit ist, dass die Lernenden in Kleingruppen oder für sich allein ein Stichwort erhalten, z.B. Serienschaltung, Sicherung, Laufwasserkraftwerk. In einem kurzen Lernvideo sollen die Lernenden diesen Begriff erklären. Die Lehrperson kann dadurch eruieren, welches Verständnis die Lernenden vom vorgegebenen Begriff haben.
Lehrplanbezug
Die Aufgaben bieten die Möglichkeit, mit Lernenden des 2. Zyklus an folgenden Kompetenzen zu arbeiten.
Lehrmittel und Grundlagen

NaTech 3/4
LehrmittelDas Themenbuch ist als Mehrwegmaterial konzipiert und farbig gestaltet. Die im Lehrplan 21 formulierten Kompetenzstufen werden in jeweils 10 Lerneinheiten umgesetzt. Mittels klärender Sachtexte, anregender Bildmaterialien und differenzierter Aufträge begegnen die Kinder naturwissenschaftlichen Themen.
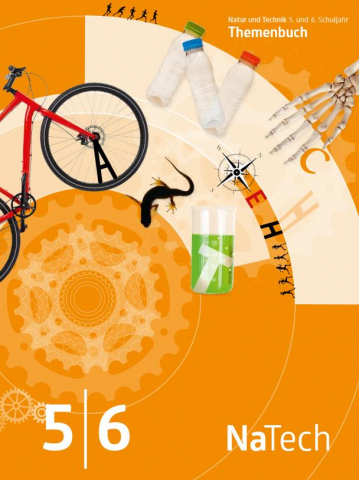
NaTech 5/6
LehrmittelDas Themenbuch ist als Mehrwegmaterial konzipiert und farbig gestaltet. Die im Lehrplan 21 formulierten Kompetenzstufen werden in jeweils 10 Lerneinheiten umgesetzt. Mittels klärender Sachtexte, anregender Bildmaterialien und differenzierter Aufträge begegnen die Kinder naturwissenschaftlichen Themen.
