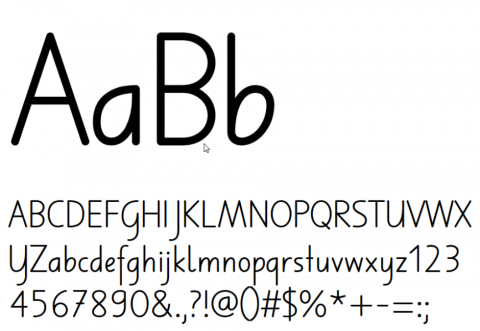Künstliche Intelligenz (KI) ist in unserem täglichen Leben allgegenwärtig. Dieses IdeenSet vermittelt Lernenden in spielerischen Übungen und mit analogen Materialien, was unter KI zu verstehen ist und wie maschinelles Lernen und aktuelle KI-Anwendungen wie ChatGPT aus informatischer Sicht funktionieren. Darauf aufbauend gibt es Impulse, wie KI in verschiedenen Disziplinen eingesetzt und reflektiert werden kann.
Relevanz und Übersicht
Trotz ihrer offensichtlichen Relevanz kommt KI im Lehrplan 21 (noch) nicht vor. Unterrichtsmaterialien zum Thema sind teilweise vorhanden, aber in Lehrmittel hält sie erst nach und nach Einzug. Weitere Hürden für die Behandlung im Unterricht sind die geringe Anzahl Lektionen im Bereich Medien und Informatik, die unklare Rechtslage für den Einsatz von Anwendungen im Unterricht sowie der fehlende Zugang für Lehrpersonen zur Thematik.
Das IdeenSet trägt dem Rechnung, indem es die Lernarrangements kompakt gestaltet und die Lehrplankompetenzen berücksichtigt. Ein fächerübergreifender Zugang ermöglicht es, sich dem vielschichtigen Phänomen entsprechend der eigenen Interessen und Fachexpertise sowie dem bereits vorhandenen Vorwissen zu nähern.
Vorstellungen und Vorkenntnisse
Am Ende des 2. Zyklus kann davon ausgegangen werden, dass die Lernenden über praktische Anwendungserfahrungen mit KI verfügen, die jedoch häufig nicht reflektiert oder bewusst gemacht worden sind. (Dietrich, 2023) Der grösste Teil der Klasse hat vermutlich auch bereits selbstständig mit generativer KI gearbeitet und alle Lernenden werden davon gehört haben.
Unabhängig von der Nutzererfahrung sind "typische" Fehlkonzepte zu erwarten, die teilweise auch bei Erwachsenen zu finden sind, z.B:
- Wahrnehmung von KI-Anwendungen und Robotern als “Zwischending” zwischen leblosem und lebendigem Objekt (Dietrich, 2023)
- Vermenschlichung / Anthropomorphisierung von KI
- Überschätzung / Fehleinschätzung von KI-Chatbots, z.B. Nutzung als Suchmaschine (Kerres, Klar & Mulders, 2024; Oertner, 2024)
Lerngegenstand und thematische Schwerpunkte
Wie bei allen komplexen Medien&Informatik-Themen bietet es sich an, Künstliche Intelligenz im Unterricht aus den drei Perspektiven des Dagstuhl-Dreiecks zu behandeln (vgl. Döbeli, 2023):
- Perspektive "Wie funktioniert das?": Verständnis als "System"; Hintergrundwissen.
- Perspektive "Wie nutze ich das?": Konkrete Auseinandersetzung mit (generativer) KI, inkl. der Reflexion der Produkte.
- Perspektive "Wie wirkt das?": Auswirkungen von KI auf die Gesellschaft, praktische Relevanz für die eigene Lebenswelt.
Das IdeenSet umfasst zwei Schwerpunkte, die grob diesen Perspektiven zugeordnet werden können:
| Schwerpunkt 1: Wie funktioniert Künstliche Intelligenz? |
Perspektive: Wie funktioniert das? Ein Grundverständnis dafür, was KI (nicht) ist und wie sie funktioniert, bildet die Basis für eine kompetente und kritische Beschäftigung mit der Thematik. Der erste Schwerpunkt vermittelt den Lernenden in kompakter Form wichtige Konzepte in drei Bausteinen:
Dieser Schwerpunkt ist als abgeschlossenes Lernarrangement aufgebaut. Jeder Baustein bietet jeweils einen didaktischen Kommentar, Vorlagen für Arbeitsblätter und -materialien sowie eine kommentierte Linksammlung, die als fachlicher Einstieg in die Thematik für Lehrpersonen dient. Es wird empfohlen, diesen Schwerpunkt als Vorbereitung für die weitere Arbeit am Thema KI mit der Klasse durchzuführen. |
| Schwerpunkt 2: Ideen für KI im Unterricht |
Perspektiven: Wie nutze ich das? / Wie wirkt das? Der zweite Schwerpunkt bietet kein detailliert ausgearbeitetes Lernarrangement, sondern eine Vielzahl von Ideen dafür, wie (generative) Künstliche Intelligenz im Unterricht reflektiert und aktiv genutzt werden kann. Der Zugang soll dabei bewusst nicht über Medien&Informatik, sondern über die Fachbereiche erfolgen. Sogenannte "Ideenkarten" bieten jeweils eine Einordnung und eine kurze Skizze der Idee, inklusive möglicher Aufträge an die Lernenden sowie Hinweis auf benötigte Materialien. Zusätzlich gibt es Verweise auf die Lernziele aus dem Schwerpunkt "Wie funktioniert Künstliche Intelligenz?", die eine aufbauende Behandlung des Themas erleichtern. Die Lehrpersonen können die Unterrichtsideen frei nach den eigenen Interessen und dem Fachbereichsprofil wählen. |
Verlauf und Lehrplanbezug
Verlauf
| Didaktische Phase * | Aufgaben |
|---|---|
| Explorieren |
Den Auftakt zum Schwerpunkt "Wie funktioniert Künstliche Intelligenz?" bildet eine Aufgabe, bei der die Lernenden KI in Alltagsphänomenen "erkennen" sollen. Diese nur auf den ersten Blick einfache Aufgabe führt zu einem Hinterfragen von Präkonzepten und der Erkenntnis, dass KI ein (historisch) wandelbarer Begriff ist, den selbst Fachexpert*innen nicht klar definieren können. Eine zu erarbeitende "Klassendefinition", die im Verlauf des Lernarrangements immer wieder herangezogen und ggf. aktualisiert werden kann, spiegelt die Offenheit des Begriffs wider und bietet eine Wertschätzung der Perspektive der Lernenden auf die Thematik. |
| Erarbeiten |
Im zweiten Baustein des Schwerpunkts "Wie funktioniert Künstliche Intelligenz?" erarbeiten sich die Lernenden verschiedene Konzepte des "Maschinellen Lernens". Sie lernen diese Konzepte kennen, indem sie eine didaktisch reduzierte Form des jeweiligen Konzepts in verschiedenen (Sortier-)Aufgaben selbst anwenden. Die Übung legt Wert darauf, die verschiedenen Konzepte nicht nur klar gegeneinander, sondern auch gegen bereits bekannte Konzepte (z.B. einfache Algorithmen, Entscheidungsbäume) abzugrenzen. |
| Üben und Vertiefen |
Im dritten Baustein des Schwerpunkts "Wie funktioniert Künstliche Intelligenz?" werden die Konzepte des maschinellen Lernens auf die generative Künstliche Intelligenz übertragen. Auch hier wird das Verständnis für diese Systeme durch praktische Übungen vermittelt: Die Lernenden stellen anhand von Outputs generativer KI-Anwendungen Vermutungen über deren Funktionsweise an. Anschliessend ahmen sie diese Funktionsweise selbst spielerisch nach. Auf diese Weise werden nicht nur die Möglichkeiten und Grenzen der Technologie in didaktisch reduzierter Form sichtbar gemacht und verbreitete Präkonzepte (z.B. Vermenschlichung, Zuschreibung zu umfassender Fähigkeiten) hinterfragt. Darüber hinaus wird eine Brücke zum Schwerpunkt 2 "KI im Unterricht" geschlagen, in dem die Arbeit mit KI-Anwendungen und deren Outputs im Zentrum steht. Das erworbene Wissen darüber, wie KI lernt und funktioniert, kann die Lernenden zu einem reflektierteren "praktischen" Umgang mit diesen Technologien führen. |
| Anwenden |
Die im Schwerpunkt 2 "KI im Unterricht" angeregte Thematisierung und Nutzung von generativer KI ist (nicht nur, aber auch) eine Anwendung der zuvor primär theoretisch entwickelten Konzepte. Viele der vorgeschlagenen Ideen verbinden eine Betrachtung der "sichtbaren" Systeme und Outputs mit einer Reflexion der dahinter liegenden Technologie. Sie machen damit die bisher abstrakt gebliebenen Konzepte in der Anwendung "erfahrbar". |
| Übertragen |
Bei den Unterrichtsideen des Schwerpunkts 2 "KI im Unterricht" geht es nie um den Einsatz von KI als Selbstzweck. KI wird vielmehr als Gegenstand der Reflexion behandelt oder als Werkzeug eingesetzt, das den Prozess der Text- oder Bildgestaltung unterstützt. (Und somit keine «fertigen Produkte» liefern soll.) Die vorgeschlagenen Aufgaben und Übungen zielen daher nicht darauf ab, reine Anwendungskompetenz zu fördern oder die Lernenden dazu zu bringen, ihre eigene Arbeit durch KI "ersetzen" zu lassen. Vielmehr sollen die Lernenden dabei begleitet werden, KI in Zukunft als ein Werkzeug unter vielen in unterschiedlichen Situationen produktiv für sich nutzen zu lernen. |
* Die didaktischen Phasen basieren auf dem Modell kompetenzfördernder Aufgabensets nach Kalcsics & Wilhelm, 2017.
Organisation
Die Übungen im Schwerpunkt 1 "Wie funktioniert Künstliche Intelligenz?" sind so angelegt, dass sie ohne Zugang zu einem Computer durchgeführt werden können. Benötigte Materialien sind im Schwerpunkt verlinkt und können selbstständig ausgedruckt werden.
Die "Ideen für KI im Unterricht" (Schwerpunkt 2) setzen in der Regel den Zugang zu einem oder mehreren Computern mit Internetzugang voraus. In den meisten Fällen sind sie so konzipiert und beschrieben, dass die Übungen mit einem KI-Dienst nach Wahl umgesetzt werden können. (Dies umfasst neben den üblichen kommerziellen Anbietern natürlich auch KI-Plattformen mit Schulen als Zielgruppe, wie z.B. Fobizz, Schabi, oder SchulKI, bei denen i.d.R. die Lernenden kein eigenes Konto anlegen müssen.)
In den Fällen, in denen dennoch eine Tool-Empfehlung gegeben wird, ist zu berücksichtigen, dass es sich um ein sehr dynamisches Feld handelt. Dienste und Anbieter wandeln sich ständig. Das IdeenSet wurde im Frühjahr 2024 erstellt, die Empfehlungen sind vor diesem Hintergrund zu verstehen.
Beurteilung
Auf Empfehlungen für eine Beurteilung wird in diesem IdeenSet verzichtet.
Lehrplanbezug
Der Lehrplanbezug, die Lernziele und die Kompetenzen werden jeweils bei den Aufgaben beschrieben.
Lehrmittel und Grundlagen
Künstliche Intelligenz findet, wie erwähnt, im Lehrplan 21 keine Erwähnung und ist auch in den meisten offiziellen Lehrmitteln (noch) nicht präsent. Unter "Hintergrundinformationen" wird jedoch eine Auswahl von Lehrmitteln und weiteren Unterrichtsmaterialien aufgeführt, ohne Anspruch auf Vollständigkeit. Diese können die Aufgaben und Impulse aus diesem IdeenSet ergänzen oder teilweise auch ersetzen; i.d.R. behandeln sie jedoch die generative KI (noch) nicht und beziehen sich nicht auf den Lehrplan 21.
Im Schwerpunkt 1 "Wie funktioniert Künstliche Intelligenz" findet sich zudem zu jedem Baustein ein Dokument mit dem Titel "Hintergrund und Wissen". Dieses bietet jeweils eine kommentierte Linksammlung, die als Einstieg in die fachliche Auseinandersetzung mit den relevantesten Konzepten und Aspekten dienen kann.
Quellen
Dietrich, K. (2023). Kindererziehung im Zeitalter der KI. Wie man mit Kindern über künstliche Intelligenz spricht, EPFL Extension School. Zugriff am 04.08.2023. Verfügbar unter https://www.thats-ai.org/de-CH/units/kindererziehung-im-zeitalter-der-ki
Döbeli, B. (2023). Textgeneratoren als mehrperspektivisches Thema in der Schule. Zugriff am 08.08.2023. Verfügbar unter https://mia.phsz.ch/Main/WebHome
Kerres, M., Klar, M. & Mulders, M. (2024). Thema: Informationskompetenz neu denken. Von Google zu ChatGPT. Erwachsenenbildung, 70 (2), 52–57. Zugriff am 14.06.2024. Verfügbar unter https://www.researchgate.net/publication/378776677_Informationskompetenz_neu_denken_Von_Google_zu_ChatGPT
Oertner, M. (2024). ChatGPT als Recherchetool? Fehlertypologie, technische Ursachenanalyse und hochschuldidaktische Implikationen. Bibliotheksdienst, 58 (5), 259–297. https://doi.org/10.1515/bd-2024-0042
Alle Bilder wurden, sofern nicht anders erwähnt, mit den KI-Bildgenerierungsservices Midjourney oder Dall-E erstellt. In Übereinstimmung mit den Empfehlungen von Creative Commons können diese Bilder frei genutzt werden im Sinn von CC 0 bzw. der Public Domain.