Die zwei Projekt sind:
Die digitale Transformation in d er Bildung umfasst mehr als den Einsatz neuer Technologien im Klassenzimmer – die gesamte Schule inklusive Schulleitungen, Lehrpersonen, Eltern und Schülerschaft ist Teil des Reformprozesses. Mit der Einführung des Lehrplans 21 war bzw. ist die Veränderung durch die digitale Transformation an öffentlichen Schulen direkt zu beobachten. Denn der neue Lehrplan sieht vor, dass Schulen mindestens zwei Lektionen pro Woche Medien und Informatik in der Primar- und Sekundarstufe I anbieten sollen.
er Bildung umfasst mehr als den Einsatz neuer Technologien im Klassenzimmer – die gesamte Schule inklusive Schulleitungen, Lehrpersonen, Eltern und Schülerschaft ist Teil des Reformprozesses. Mit der Einführung des Lehrplans 21 war bzw. ist die Veränderung durch die digitale Transformation an öffentlichen Schulen direkt zu beobachten. Denn der neue Lehrplan sieht vor, dass Schulen mindestens zwei Lektionen pro Woche Medien und Informatik in der Primar- und Sekundarstufe I anbieten sollen.
Fragen, die im Rahmen des SNF-Projekts "Reform@work" untersucht werden, lauten: Welche Veränderungen sind notwendig, um eine digitale Transformation an öffentlichen Schulen zu ermöglichen? Wie kann ein solcher Wandel erleichtert werden? Welche Aspekte des Schullebens sind betroffen? Und wie wird ein "Erfolg der Reform" bestimmt?
Das föderale System der Schweiz überträgt den Kantonen die Verantwortung für die Umsetzung von Schulreformen – entsprechend heterogen fällt die Bildungslandschaft in der Schweiz trotz einheitlichem Lehrplan aus. In einem ersten Schritt werden im Forschungsprojekt in sechs Kantonen systematisch die schulischen Praktiken zur Implementation des neuen Schulfachs dokumentiert und die unterschiedlichen Visionen und Vorgaben der Politik betrachtet. Insbesondere interessiert die Schnittstelle zwischen Politik und Praxis – wo politische Annahmen auf den Alltag der Lehrerinnen und Lehrer treffen. Der Vergleich zwischen den sechs vertiefenden Fallstudien ermöglicht es, Ähnlichkeiten und Unterschieden zwischen den Schulen und institutionellen Kontexten herauszuarbeiten. Die erkannten Muster werden anschliessend anhand einer Datenerhebung in fünf weiteren Schulen jedes Kantons empirisch überprüft.
Die Ergebnisse aus dem SNF-Projekt werden das Wissen über Bildungsreformen im Allgemeinen und besonders zur digitalen Transformation in öffentlichen Schulen erweitern und das Verständnis fördern, wie Akteurinnen und Akteure aus dem Berufsfeld Schule ihre Praktiken an politische Entscheide anpassen. Diese Grundlagen werden dazu beitragen, Herausforderungen und Möglichkeiten von Schulreformen in Zukunft noch besser einzuschätzen.
| Vollständiger Titel | Reform@work: A Multi-Perspective Study of Policy and Practice in the Swiss Curriculum Reform on Media and Informatics (Reform@work: Eine multiperspektivische Studie zu Politik und Praxis der Schweizer Lehrplanreform im Bereich Medien und Informatik) |
| Team | Prof. Dr. Ueli Hostettler (Leitung) Dr. Michelle Jutzi Marina Grgic, MSc Thomas Wicki, MSc |
| Dauer | 1. März 2020 – 29. Februar 2024 |
| Link | http://p3.snf.ch/project-188867 |
Auf dem Weg zu einer inklusiven Grafomotorik
Das SNF-Forschungsprojekt zum Thema Grafomotorik hat zum Ziel, separative, integrative und inklusive Settings der grafomotorischen Förderung zu vergleichen sowie die Zusammenhänge zwischen exekutiven Funktionen und grafomotorischen Leistungen zu untersuchen.
Für 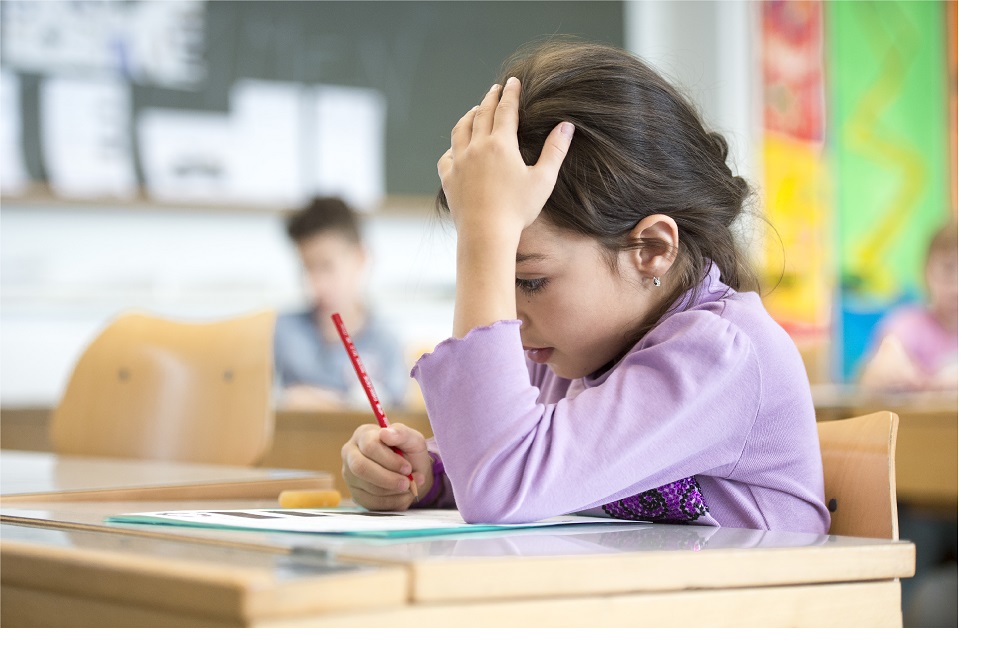 einen gelingenden Schulstart und für erfolgreiches schulisches Lernen spielen psychomotorische Fähigkeiten eine entscheidende Rolle. Diese stehen in enger Wechselwirkung mit der Entwicklung exekutiver Funktionen und mit der Sprachentwicklung. Obwohl auf internationaler Ebene (UNO, Behindertenrechtskonvention 2006, Art.24) schon länger integrative bzw. inklusive schulische Settings gefordert werden, finden Logopädie und Psychomotorik hierzulande immer noch fast ausschliesslich in Einzel- und Kleinstgruppensitzungen ausserhalb des Klassenzimmers statt. Dieser Zustand erschwert möglicherweise den Transfer von Fachwissen in den Handschriftenunterricht und in den übrigen Schulalltag.
einen gelingenden Schulstart und für erfolgreiches schulisches Lernen spielen psychomotorische Fähigkeiten eine entscheidende Rolle. Diese stehen in enger Wechselwirkung mit der Entwicklung exekutiver Funktionen und mit der Sprachentwicklung. Obwohl auf internationaler Ebene (UNO, Behindertenrechtskonvention 2006, Art.24) schon länger integrative bzw. inklusive schulische Settings gefordert werden, finden Logopädie und Psychomotorik hierzulande immer noch fast ausschliesslich in Einzel- und Kleinstgruppensitzungen ausserhalb des Klassenzimmers statt. Dieser Zustand erschwert möglicherweise den Transfer von Fachwissen in den Handschriftenunterricht und in den übrigen Schulalltag.
Das SNF-Projekt "Separative, integrative und inklusive Settings der grafomotorischen Förderung" hat zum Ziel, die verschiedenen Settings der grafomotorischen Förderung – separativ, integrativ und inklusiv – zu vergleichen. Ein weiterer Fokus des Projekts ist die Untersuchung von exekutiven Funktionen in Bezug auf grafomotorische Leistungen. Dies erfolgt in Kooperation mit der Universität Bern.
Die zentralen Fragestellungen lauten:
- Inwiefern unterscheiden sich Schülerinnen und Schüler mit verstärkten, moderaten oder keinen grafomotorischen Schwierigkeiten in den verschiedenen Settings hinsichtlich ihrer grafomotorischen Leistung, ihres allgemeinen und schreibbezogenen Selbstkonzepts?
- Welcher Zusammenhang besteht zwischen der Grafomotorikleistung und den exekutiven Funktionen eines Kindes?
- Wie wirkt sich die multiprofessionelle Zusammenarbeit in den verschiedenen Settings auf die Lehrpersonen und auf die Psychomotoriktherapeutinnen bzw. -therapeuten aus?
Für das Projekt wird ein Prä-Post-Design gewählt. Die grafomotorische Förderung wird während 16 Wochen a) in herkömmlicher Form, b) in einer integrativ ausgerichteten Zusammenarbeit oder c) mittels eines inklusiven Programms erteilt. Alle Lehr- und Fachpersonen erhalten im Rahmen einer Weiterbildung die gleichen Fördermaterialien. Sie arbeiten während der Interventionsphase in ihrem Setting an den vorgegebenen Schwerpunkten. Die Kinder werden vor und nach dieser Phase sowie nach weiteren sechs Monaten untersucht.
Die gewonnenen Erkenntnisse sollen mithelfen, bestehende Forschungslücken zu schliessen, liegen doch bis anhin im deutsch- sowie englischsprachigen Raum kaum Ergebnisse zur Wirksamkeit unterschiedlicher Formen der grafomotorischen Förderung vor. Auch fehlen Untersuchungen zu Zusammenhängen zwischen exekutiven Funktionen und grafomotorischen Leistungen weitgehend. Für die Praxis werden wichtige Hinweise zur grafomotorischen Förderung und für die multiprofessionelle Zusammenarbeit erwartet.
| Vollständiger Titel | Separative, integrative und inklusive Settings der grafomotorischen Förderung: Wirkungen auf die Schülerinnen und Schüler sowie die Fach- und Lehrpersonen |
| Team | Prof. Dr. Michael Eckhart (Leitung) Judith Sägesser Wyss (Leitung) Lidia Truxius, Doktorandin Universität Bern Kooperation: Prof. Dr. Claudia Roebers, Universität Bern Michelle Maurer, Universität Bern |
| Dauer | 1. März 2020 – 30. April 2023 |
| Link | www.grafset.ch/ |