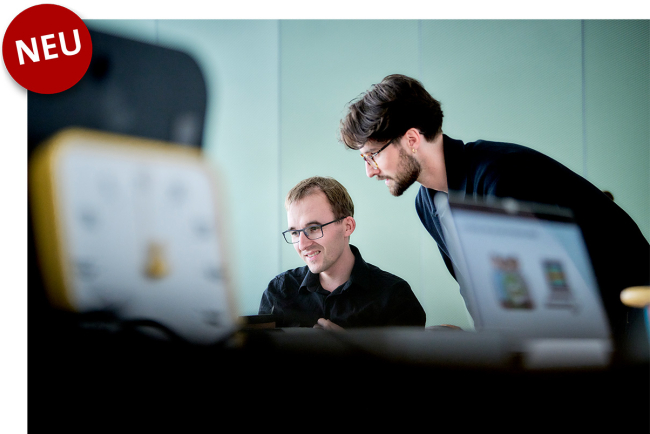Lernen und Lehren inklusiv gestalten: Der neue CAS-Lehrgang unterstützt Fachpersonen aus Schulen, Hochschulen und weiteren Institutionen dabei, inklusive Kulturen, Strukturen und Praktiken zu gestalten.
Dieser CAS-Lehrgang richtet sich an Fachpersonen aus Unterricht und Bildung. Die Teilnehmenden lernen, wie sich Lern- und Lehrprozesse inklusiv und wirksam gestalten lassen. Sie befassen sich mit kooperativen Arbeitsformen, dem Universal Design for Learning, digitaler Barrierefreiheit sowie inklusiver mündlicher und schriftlicher Kommunikation. Gemeinsam mit erfahrenen Expert*innen entwickeln sie Strategien, die den Transfer in die eigene Praxis sichern und nachhaltig Wirkung entfalten.
Was zeichnet den CAS-Lehrgang aus?
- Inklusive Arbeitssettings: Teilnehmende lernen Materialien und Strategien zur Gestaltung von Arbeitssettings kennen, die die Potenziale aller Beteiligten fördern und die Vielfalt als Ressource nutzen. Good practice Beispiele geben Einblick in gelingende Projekte aus Bildung und Privatwirtschaft.
- E-Accessibility und Leichte Sprache: Im CAS-Lehrgang werden Kompetenzen in den Bereichen digitale und analoge Barrierefreiheit aufgebaut, mit dem Ziel, Inhalte und Angebote für alle zugänglich und verständlich gestalten zu können.
- Praxisnahe Zusammenarbeit: In ausgewählten Veranstaltungen partizipieren Teilnehmende der Diplomausbildung Fachperson Inklusion (F-INK) für Menschen mit Behinderungen. Diese Kooperation bereichert den CAS-Lehrgang, indem der echte und gewinnbringende Umgang mit Vielfalt gelebt und erlebt wird.
Aufbau
Der CAS-Lehrgang umfasst 3 Module. Die Präsenzveranstaltungen finden jeweils freitags statt; genaue Daten und Unterrichtszeiten folgen.
Die Module dieses Lehrgangs können auch einzeln absolviert werden. Übersteigt die Anzahl Anmeldungen die Platzzahl, haben jene Teilnehmenden Vorrang, die den ganzen Lehrgang besuchen. Details sind dem Lehrgangsprogramm zu entnehmen.
Unterrichtssprache ist Deutsch. Für die Teilnahme wird ein Sprachniveau Deutsch C1 gemäss dem Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmen für Sprachen (GER) vorausgesetzt.
Modul 1: Grundlagen der Inklusion
Die Teilnehmenden können:
- die Begriffe Inklusion und Integration differenziert verwenden,
- Behinderung aus verschiedenen Perspektiven betrachten und mehrere Dimensionen von Behinderung erläutern,
- die rechtlichen Grundlagen und Gesetzgebungen für Menschen mit Behinderung auf nationaler und internationaler Ebene erläutern und kritisch analysieren, was diese Rechte für Betroffene im beruflichen Alltag bedeuten,
- erkennen, wie persönliche Einstellungen und Haltungen das eigene Verständnis über Inklusion beeinflussen,
- Bildungs- und Arbeitsmöglichkeiten für Menschen mit Behinderung auf Grundlage aktueller Forschungsergebnisse einordnen und diskutieren,
- eigene Lehr-, Beratungs- und Informationsangebote mittels kooperativer Lern- und Arbeitsformen und den Prinzipien des Universal Designs für heterogene Gruppen so gestalten, dass die Vielfalt der Teilnehmenden berücksichtigt wird,
- Methoden und Strategien zur inklusiveren Gestaltung von Arbeitswelten benennen und daraus Ideen zur Optimierung der eigenen Praxis ableiten.
Modul 2: E-Accessibility
Die Teilnehmenden können:
- Zielgruppen und deren spezifische Bedürfnisse
- Definition und Merkmale der E-Accessibility
- Internationale Richtlinien zur digitalen Barrierefreiheit
- Zugänglichkeitsprüfungen digitaler Kommunikations- und Informationskanäle
- Gestaltungs- und Entwicklungsmöglichkeiten barrierearmer digitaler Inhalte
- Assistive Technologien
- Prozesse für die nachhaltige Verankerung der Barrierefreiheit in Organisationen
Modul 3: Grundlagen und Anwendung der Leichten Sprache
Die Teilnehmenden können:
- erläutern, warum der Einsatz der Leichten Sprache für eine grosse Gruppe von Menschen wichtig ist,
- Merkmale und Regeln der Leichten Sprache und der Einfachen Sprache beschreiben und die beiden Textkategorien unterscheiden,
- begründen, warum der Einsatz der Leichten Sprache nebst Chancen auch Risiken birgt,
- Texte anhand der Regeln für Leichte Sprache auf ihre Verständlichkeit hin beurteilen,
- Künstliche Intelligenz für das Erstellen von Texten in Leichter Sprache nutzen und die Grenzen dieser Technologie kritisch diskutieren,
- komplexe Texte in Leichte Sprache umschreiben,
- grafische Elemente zur Visualisierung der Texte nutzen,
- Leichte Sprache in Gesprächen anwenden,
- sich mit Selbstbetroffenen mit unterschiedlichen Lernvoraussetzungen austauschen und professionell auf deren Bedürfnisse bezüglich der Leichten Sprache eingehen.
Abschlussmodul
Die Teilnehmenden können:
- eine für ihre berufliche Tätigkeit relevante und in die Thematik des CAS-Lehrgangs eingebettete Fragestellung identifizieren,
- die Fragestellung datengestützt, korrekt und nachvollziehbar bearbeiten, die Bearbeitung der Fragestellung reflektieren sowie diskutieren,
- ihre Abschlussarbeit einem Publikum präsentieren und in der anschliessenden Diskussion Stellung zu wissenschaftlichen und praxisrelevanten Fragen nehmen.
Die Abgabe der Abschlussarbeit erfolgt auf Ende August.