Verlauf und Lehrplanbezug
Ziel
Im Fokus dieser Aufgaben steht die Kompetenz: RZG 7 des Lehrplan 21: “Geschichtskultur analysieren und nutzen“ Es soll die Frage gestellt werden, wie ein kritischer Umgang der heutigen Gesellschaft mit der Vergangenheit generell und mit der Verflechtung der Schweiz in den Kolonialismus im besonderen aussieht bzw. aussehen könnte. Bei allen Aufgaben wird die Sachkompetenz gefördert – diese wird nicht mehr speziell ausgewiesen.
Zeit
Die Aufträge ohne Vertiefung sind auf ca. 2-3 Lektionen angelegt, die Vertiefungsaufträge umfassen, wenn man sie gruppenteilig löst und einen Austausch einplant, erneut ca. 2 Lektionen.
| Didaktische Phase * | Aufgaben |
|---|---|
|
Explorieren erkunden, begegnen, Vorwissen und Erfahrungen aktivieren, Konzepte prüfen und hinterfragen, aktiventdeckend |
Heranführen: Die Vergangenheit in der Gegenwart Die Lernenden erhalten drei Fotos, welche einen Bezug zum Thema «Schweiz» und «Kolonialismus» haben. Damit soll zum einen das Vorwissen der Lernenden aktiviert werden, auch jenes aus den vorangegangenen Lektionen. Konzepte sollen überprüft und hinterfragt werden. Die Lernenden sollen zum andern auch dazu angeregt werden, Fragen zu formulieren und Thesen aufzustellen. Didaktische Prinzipien und historische Kompetenzen: |
|
Erarbeiten neue Konzepte und Handlungsweisen kennenlernen, ordnen |
Die Zunft zum Mohren - eine politische Debatte Der Abdruck aus dem «Idiotikon» stellt die Debatte um den Begriff in den Schweizer Kontext, in welchem die rassistische Konnotation unverkennbar ist. Aus den vorangehenden Lektionen wissen die Lernenden um die Problematik des «othering». In diesem Fallbeispiel geht es um das Bild Schwarzer Menschen aus Afrika im 19. Jh., welches im Wappen der Zunft repräsentiert ist. Diskussion Didaktische Prinzipien und historische Kompetenzen: |
|
Vertiefen trainieren, erweitern, für sich verfügbar machen |
Einen Eintrag auf einer Homepage formulieren Didaktische Prinzipien und historische Kompetenzen: |
|
Anwenden in bekannten Situationen |
Die Thematik des gesellschaftlichen Umgangs mit Geschichte kann auf weitere Themen ausgeweitet werden – idealerweise werden aktuelle Debatten in den jeweiligen Kantonen aufgegriffen. Alfred Escher: Sklavenhalter oder Eisenbahnkönig? Wie wurde aus dem Espace Louis Agassiz der Espace Tilo Frey? Schon länger forderte ein Komitee, den Platz Louis Agassiz umzubenennen. Wie Escher war auch Agassiz eine umstrittene Persönlichkeit: Neben vielen Verdiensten, insbesondere in der Eiszeitforschung, vertrat er die Rassentheorien des 19. Jh. und schrieb äusserst abwertend über schwarze Menschen. Die Lernenden erfahren aus einem Darstellungstext, einem SRF-Beitrag sowie einer Internetrecherche die Gründe für die Umbenennung des Platzes. Auch die Kontroversen werden sichtbar gemacht. Didaktische Prinzipien und historische Kompetenzen: |
|
Synthese/Exkurs in unbekannten Situationen |
Die Schlussdiskussion zielt auf einen kritischen Umgang der Gesellschaft mit Geschichte ab. Die Auseinandersetzung mit der Geschichtskultur soll sichtbar machen, dass die Meinungen darüber, wie eine Gesellschaft mit problematischer Geschichte und problematischen Geschichten umgehen sollte, divergieren. Sollen rassistische oder aus heutiger Sicht problematische geschichtskulturelle Repräsentationen (Bilder, Statuen, Strassennamen) entfernt werden? Oder soll – beispielsweise in Form einer Plakette – über die historischen Hintergründe informiert werden? Welche unterschiedlichen Stimmen gibt es? Was sagen die Diskussionen über die Gegenwart aus? Am Ende der Einheit wird die Frage aufgegriffen, welche Lehren es heute aus der Vergangenheit zu ziehen gibt. In Bezug auf das «othering» werden die Lernenden gefragt, ob es heute noch Menschen gibt, die aus der Gesellschaft ausgeschlossen werden (Menschen mit einer Behinderung? Flüchtende Menschen? Menschen mit einer anderen sexuellen Orientierung? Menschen mit einem anderen Glauben? Etc.) und ob spätere Generationen «uns» dies zum Vorwurf machen könnten. Eine Unterrichtseinheit zum Thema Menschenrechte könnte hier anschliessen. Didaktische Prinzipien und historische Kompetenzen: |
* Die didaktischen Phasen basieren auf dem Modell kompetenzfördernder Aufgabensets nach Kalcsics & Wilhelm, 2017.
Beurteilen
Es lassen sich verschieden Produkte und Prozesse formativ beurteilen, so zum Beispiel die in der Debatte zur «Zunft zum Mohren» aufgeführten und vertretenen Argumente aber auch der mögliche Eintrag auf der Homepage. Dabei sind vor allem die Kriterien «Multiperspektivität» / «Sachrichtigkeit (Sachkompetenz)» / «Argumentation» zu berücksichtigen.
Zur summativen Beurteilung eignet sich z.B eine Prüfungsfrage zur Wichtigkeit von Erinnerungsorten Diese könnte auf eine Generalisierung hinauslaufen: «Weshalb braucht eine Gesellschaft Erinnerungsorte?» «Wie erinnert sich unsere Gesellschaft an ihre Vergangenheit?»
→ Jedes Land (jede Nation) konstruiert sich seine Geschichte (Nationen als «vorgestellte Gemeinschaften» (Anderson)). An diese Geschichte erinnern auch zentrale Erinnerungsorte wie Denkmäler, Statuen, aber auch physische Orte wie «das Rütli» oder Museen. Diese helfen bei der Stiftung eines Zusammenhalts, bei der Stiftung einer Identität. Solche Orte sollten nicht nur die «heroischen» Seiten der (National-)Geschichte beleuchten, sondern auch kritische Blicke auf die Vergangenheit ermöglichen und die Diversität einer Gesellschaft sowie die Verflechtungen in globale Zusammenhänge zeigen.
Auch Veränderungen in der Geschichte durch neue Fragestellungen könnten in einer Prüfung diskutiert werden: «Weshalb hat man sich in der Schweiz lange nicht an die Verstrickungen in den Kolonialismus / in die Sklaverei erinnert?» -> Zu lange glaubte man, ein Land, das keine Kolonien besass, müsse sich auch nicht an diese koloniale Geschichte erinnern. Mit Themen wie der «Sklaverei» hätte die Schweiz nichts zu tun gehabt.
Unterrichtsmaterial

Die koloniale Erinnerungskutlur
UnterrichtsmaterialienIm Fokus dieser Aufgaben steht die Kompetenz: RZG 7 des Lehrplan 21: “Geschichtskultur analysieren und nutzen“ Es soll die Frage gestellt werden, wie ein kritischer Umgang der heutigen Gesellschaft mit der Vergangenheit generell und mit der Verflechtung der Schweiz in den Kolonialismus im besonderen aussieht bzw. aussehen könnte. Diese Fragen werde anhand von konkreten Beispielen aus dem Alltagsraum der Lernenden erörtert.

Rassismus im Schulbuch? Eine Schulbuchanalyse am Beispiel von Afrikabildern
UnterrichtsmaterialienDurch die rassismuskritische Analyse von Schulbuchpassagen lernen die Lernenden, Stereotypen und kolonialrassistischen Darstellungen zu dekonstruieren. Die Sequenz ist auf zwei Lektionen ausgelegt. Nach einem thematische Einstieg und einem Input zur Definition von Rassismus analysieren die Lernenden verschiedene Ausschnitte aus Schulbüchern, welche sie aktuell benutzen gemäss einem Analyseleitfaden und werten ihre Ergebnisse im Plenum aus.
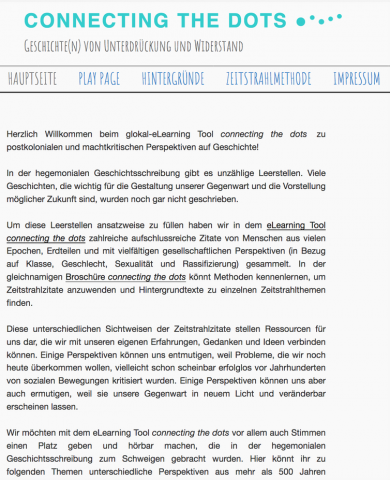
Connecting the dots
WebsiteDie Webseite ermöglicht die Arbeit im Unterricht mit Zitaten auf einem Zeitstrahl. Verschiedene Zitate von Menschen aus diversen Epochen und Erdteilen zu Themen wie Arbeit, Gender, Kolonialismus, Migration und Flucht etc sind auf der Webseite einzusehen. Mit dem E-Learning-Tool können die Zitate nach Themen auf einer Zeitachse verordnet werden. Zu jedem Zitat stehen Kurzbiographien, Interpretationshilfen und Tipps zum Weiterlesen zur Verfügung. Diese Methode soll es ermöglichen, unterschiedliche Stimmen nebeneinander zu stellen und eine andere Perspektive auf die Geschichtsschreibung, etwa in Bezug zum Thema Kolonialismus, zu vermitteln. Die Zitate überraschen, irritieren und hinterfragen eigene Denkmuster. Hinweis: Die Website ist auch nutzbar ohne die ergänzende Publikation.